Touren
Inhalt:
Felukkafahrt von Assuan nach Luxor
Schritte in dunkler Nacht
Von Dakhla nach Farafra – 112 Jahre "nachgewandert"
Von Kairo nach Abu Simbel
Mit Kamelen in die Wüste – Portrait eines Kölners: Dr. Carlo Bergmann
Bahn-Trekking (von Genf nach Kairo)
Fahrradtour nach... Afrika
Pharaonen-Rallye – Ein Fluch der Pharaonen
Cross-Sahara – der etwas andere Reisebericht
![]()
![]()
![]()
Felukkafahrt von Assuan nach Luxor
von Anne van der Zel
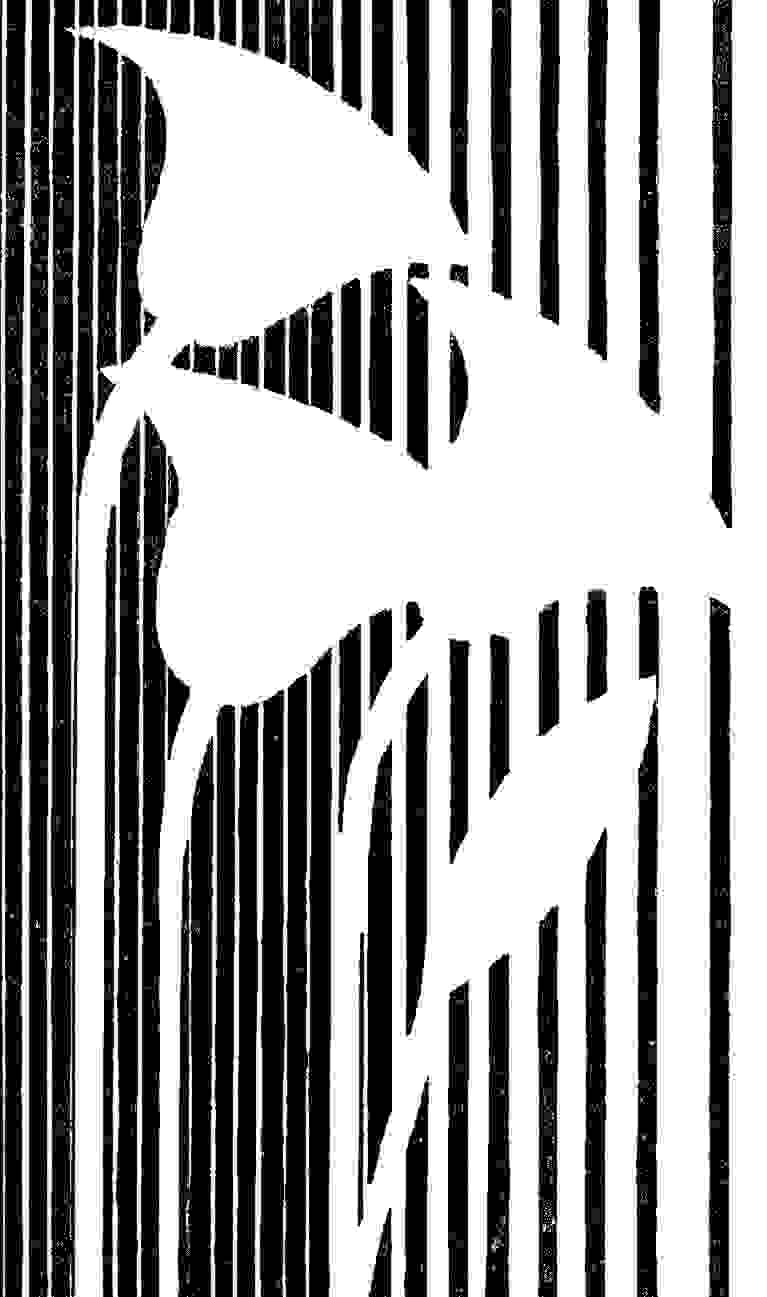 Nr. 4/84, pp. 18—21
Nr. 4/84, pp. 18—21
Wie in Kairo verabredet, liegt das Boot morgens für uns bereit am Kai von Assuan. Die "Lizil" ist 9 m lang, 3 m breit und der Giekbaum, an dem das Segel hängt, mißt 15 m. Das Plankendeck, das den ganzen hinteren Teil des Bootes vom Mittelschwert ab bedeckt, wird für die nächsten Tage unser Aufenthalt sein. Auf dem Deck liegen Schaumgummimatten, darüber Laken – angenehm weich. Die Besatzung, Mahmud (17), Abdel Nebbi (20) und Ahmed (19), wartet auf uns und hilft uns mit unserem Gepäck an Bord. Die Sonne scheint, und es weht eine frische Brise, wie üblich aus Norden.
Bevor wir Assuan verlassen, müssen wir uns alle, Boot, Besatzung und Passagiere, polizeilich registrieren lassen. In der Zwischenzeit bäckt Abdel Nebbi Fisch im Boot, im offenen Raum zwischen Mast und Schwert. Als wir nach einer guten dreiviertel Stunde zurückkommen, geht es los. Die Fahrt und das erste Essen.
Der Fluß ist hier recht schmal. An beiden Seiten sieht man Wüste, dann und wann am Wasser entlang einen schmalen Streifen Grün mit vielen Dattelpalmen. Hier und da kleine Felseninseln. Da steht ein Reiher.
Das Nachmittagslicht gibt dem Grün am Ufer einen leuchtenden Anstrich. Die Palmen wachsen sehr üppig hier und sehen bei weitem nicht so staubig aus wie in Kairo. Die Stämme scheinen violett-rot und tief-orange. Als die Sonne untergeht, steigt ein unglaublich großer Mond empor. Es kühlt jetzt sehr schnell ab. Eilig holen wir unsere Schlafsäcke hervor. Noch immer weht ein kräftiger Wind, und es ist aufregend, so im Dunkeln über das vom Vollmond leuchtende, glitzernde Wasser zu fahren. Um halb acht legen wir an einer Insel an. Wieder essen wir Fisch, diesmal mit Tomaten und Zwiebeln, lecker gewürzt, mit Reis und Brot. Wir beenden den Tag mit einem Schnaps und breiten unsere Schlafsäcke auf dem Deck aus. Die Mannschaft schläft unter dem Vorderdeck.
Noch bevor die Sonne aufgeht, im nebligen rosa Morgenlicht, stößt der Schiffer das Boot ab. Das Wasser ist spiegelglatt, es wird von keinem Hauch gekräuselt. Langsam schaukeln wir stromabwärts. Mit einem langen Ruder korrigiert Mahmud den Kurs, wenn ein Motorschiff herankommt. Um sechs Uhr ist jeder wach. Die Mannschaft raucht Wasserpfeife. Eine Stunde später taucht einer nach dem anderen ins Wasser. Es wird tüchtig geseift und geprustet. Danach ein herrlicher heißer Kaffee.
Mittlerweile ist Kom Ombo in Sicht. Es liegen sechs große Hotelschiffe den Kai entlang, aber trotzdem ist alles still. Schläft etwa noch alles? Zwischen acht und neun besichtigen wir den Tempel, und um halb zehn gleiten wir wieder über den Strom, der Wüste meistens ganz nahe. Eine Herde Kamele kommt ans Wasser, trinkt. Es ist so ruhig, wir fühlen uns als Teil der Umgebung.
Die Kinder spielen, schneiden, kleben. Abdu zeichnet unser Boot. Wir hören nur das Knarren der Planken, das Klatschen des Wassers.
Nachmittags gibt es noch immer fast keinen Wind. Unsere Ruhe wird jäh gestört. Plötzlich springt die Mannschaft auf und winkt mit weißen Kopftüchern einem Zuckerschiff. Wir werden ins Schlepptau genommen. Dieser Lauf der Dinge gefällt uns nicht sehr. "Ohne Wind machen wir nicht genug Kilometer", antwortet der Schiffer. Das Segel wird aufgerollt, und zwei Stunden lang hängen wir hinter dem ratternden Zuckerkahn.
Die ersten Zeichen von Sonnenbrand machen sich bemerkbar. Um fünf werden wir abgehängt und ankern im Fluß vor Edfu. Wir essen, trinken Tee und Schnaps, werden auf ägyptische Namen umgetauft, dafür bekommen die Burschen holländische. Es ist angenehm, daß wir genügend arabisch sprechen, um uns gut zu verständigen, aber nicht genug, um all ihren Gesprächen wörtlich zu folgen. So behält jeder seine Freiheit. Die Nacht ist weniger kalt als die letzte.
Nach dem Tee um sechs Uhr fahren wir nach Edfu. Der Horus-Tempel liegt 2 km vom Fluß. Ein Schnelläufer unter uns geht voran, wir folgen, zur großen Freude der Kinder, in einer Kutsche im Galopp.
Um halb neun kehren wir zurück ins Boot. Es gibt wieder keinen Wind. Wir fahren paddelnd unter der Brücke durch und schaukeln weiter während des Frühstücks aus Kaffee, Tee, Marmelade, Brot und Schmelzkäse.
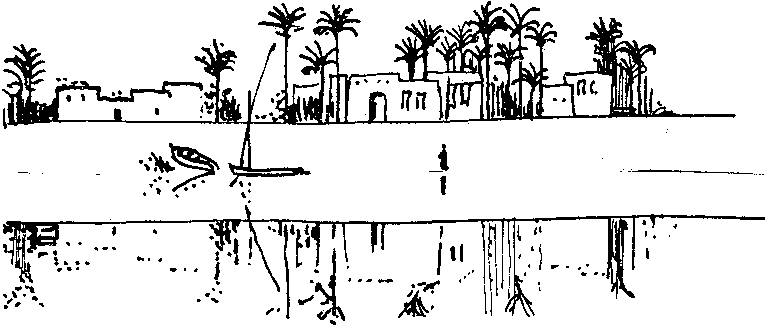
Die Dörfchen jenseits des Flusses mit ihren azurblauen, sanftgelben oder bloß erdfarbigen Häusern, zwischen Palmen, doppelt zu sehen, einmal nach unten im Nil, sind herzerobernd schön. Am Nachmittag nimmt der Wind schnell zu und wir schießen über das Wasser. Am Abend zeichnen die Silhouetten der prächtigen Palmenwälder und Röhrichte sich scharf ab gegen das Türkis des Himmels. Ein faszinierendes Schauspiel. Später, als der Himmel rot ist, fliegen Scharen von Gänsen über das Wasser.
Bei Sonnenuntergang lernt die Mannschaft Siebzehnundvier. Die Stimmung ist ausgezeichnet. Wir fahren im Dunkeln weiter, essen segelnd gebratenes Huhn mit Reis, Gemüse, Brot. Wir legen am rechten Ufer an, Esna gegenüber.
Als wir aufwachen, haben wir gleich einen guten Wind. Um acht fahren wir auf die andere Seite, nach Esna. Wir wandern durch den Ort, der arm, aber gepflegt wirkt, zum Chnum-Tempel in der Mitte des Städtchens. Wir kaufen Bananen, Orangen und Süßigkeiten und spazieren zum Damm. Unser Boot liegt tief unten in der Schleuse, zusammen mit einem riesigen Hotelschiff. Um 10 Uhr gehen wir wieder an Bord. Es weht inzwischen stark. Alle Kleider bleiben an, schwimmen ist nicht möglich heute.
Wir sehen ein Tier. Es ist größer als ein Salamander, aber kleiner als ein Krokodil, wohl ein Waran. Die Jungen wollen es mit der langen Stange töten. "La, la, la, la-a" schreien wir, und glücklich schwimmt es unverletzt, den Kopf über das Wasser erhoben, zur anderen Seite. Wir sehen übrigens auf der ganzen Fahrt, auch jetzt, eine Unzahl von Vögeln: Reiher verschiedener Arten, Wildgänse, Eisvögel, Löffler. Sie sind auf Sandinseln, im Fluß und am Ufer.
Wir fahren durch ein weites Zuckerrohrgebiet. Abdu und Mahmud gehen von Bord. Sie klauen Zuckerrohr für uns. Mahmud wird gehänselt: wir fahren knapp am Ufer entlang, immer so, daß er gerade nicht aufspringen kann. Als es ihm endlich gelingt, ist er vom Rennen ganz außer Atem. Sie bleiben guter Laune und machen Scherze mit den Männern, die am Ufer angeln und den Frauen, die dort waschen und Wasser holen.
Später wird wieder Karten gespielt und Essen gemacht. Wir sehen immer mehr Zuckerrohrschiffe und passieren eine große Zuckerfabrik. Vor der untergehenden Sonne gibt uns die riesige schwarze Rauchsäule einen Eindruck von der Hölle. Sehr dramatisch.
Der Wind nimmt ab, und wir fahren leise weiter, an großen Röhrichten entlang, wo Bauern in farbenfroh bemalten Nachen Rohr schneiden. Später legen wir unweit des Dorfes von Abdel Nebbi an. Der schläft also zu Hause.
Mit dem neuen Tag ist die Welt wieder von einem geheimnisvollen Nebel verhüllt. Die Berge jenseits des Flusses scheinen zart und wirken gar nicht so alt im ersten Sonnenlicht. Das Wasser schlägt mild gegen unser Boot und die Kähne, die die Bauern in der Nähe vertäut haben.
Mahmud und Abdu machen ein Feuer am Ufer, woran wir uns wärmen. Bauern kommen vorbei, und wir plaudern. Es ist der letzte Morgen. Mit wenig Wind fahren wir langsam zum Ziel. Schon mit Schwermut im Herzen wegen der schönen Zeit, der Sonne und der Ruhe, die wir hinter uns lassen, verabschieden wir uns von Mahmud, Abdel Nebbi, Ahmed und dem Schiff und stürzen uns ins rührige und touristische Luxor.
Hinweis: Diese Reise ... kostete ohne Trinkgelder inklusive Verpflegung LE 60,- pro Erwachsenen, LE 30,- pro Kind. Wir waren sieben Personen: 4 Erwachsene und 3 Kinder (5, 6, 12). ... Mitgenommen hatten wir warme Kleidung und Schlafsäcke, Spielzeug für die Kinder und diverse Getränke.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
![]()
Schritte in dunkler Nacht
von Carlo Bergmann
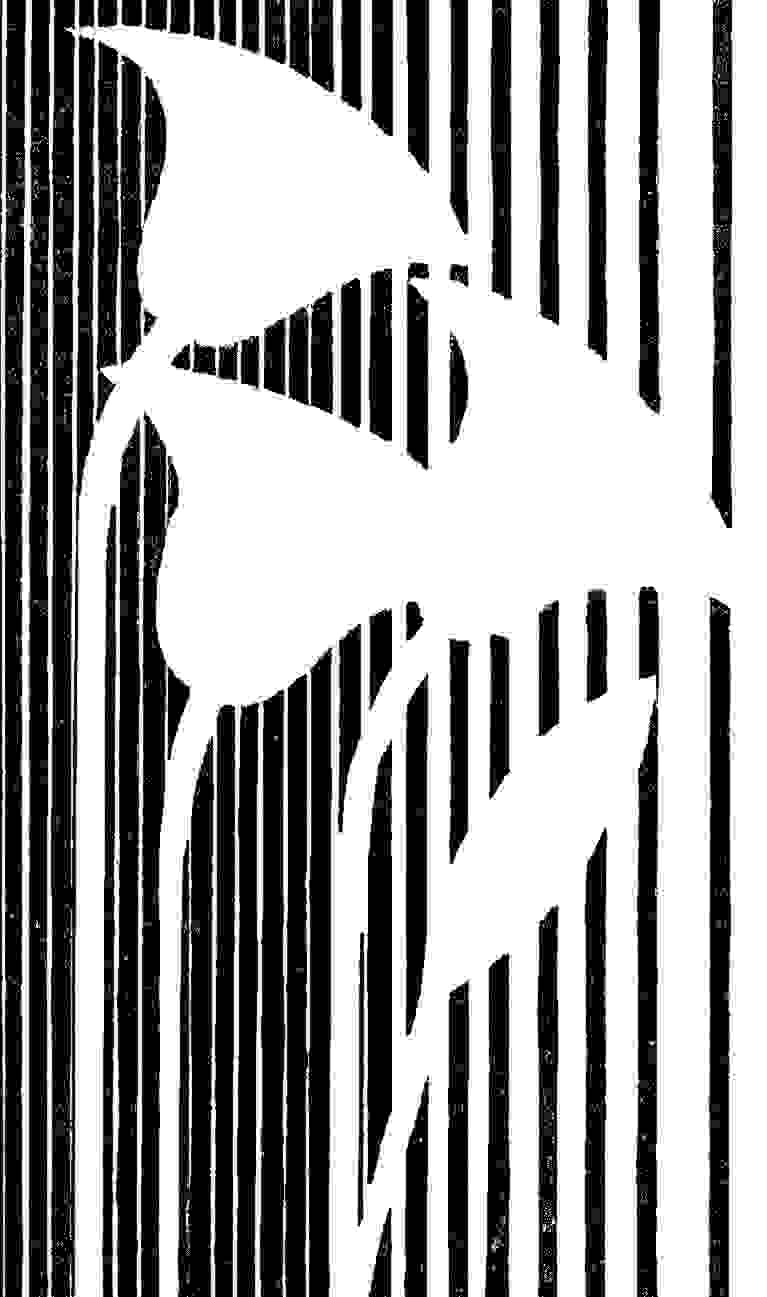 Nr. 5—6/88, pp. 81—83
Nr. 5—6/88, pp. 81—83
Tracy und ich waren per Anhalter zwischen Quseir und Marsa Alam unterwegs; am Roten Meer in Ägypten. Wir wollten zur Umm Rûs-Goldmine, Ausgangspunkt einer Wüstenwanderung Richtung Nil. Ein Fischer hatte uns mitgenommen und 50 Kilometer vor dem Ziel auf der holprigen Küstenstraße abgesetzt. Abenddämmerung. Weit und breit kein Fahrzeug.
Dunkelheit brach herein. Die ersten Sterne flackerten am Himmel, durchdrangen den dünnen Dunstschleier, der sich über das Land gebreitet hatte. Himmel und Erde verschwammen allmählich ineinander. Finsternis. "Sollen wir uns nicht noch ein wenig die Füße vertreten, ehe wir hier auf dem Asphalt einschlafen?" Ich hatte auf Tracy's Frage gewartet. Schon schulterten wir unsere Rucksäcke und machten uns auf den Weg.
Monotonie der Schritte. Tracy und ich: Jeder in Gedanken versunken, den Eindrücken des Dunkels und der Stille hingegeben.
"Hörst Du das auch?", platzte Tracy in meine Träumereien, "Schritte, dicht hinter uns. Schon eine ganze Weile lang." Seltsame Sache. Wer mochte da so grußlos zu uns aufgeschlossen haben? Das war in diesen Breiten unter Wandersleuten nicht der Brauch.
"Vielleicht haben die uns noch nicht bemerkt. Geben wir ihnen noch etwas Zeit", raunte ich zu meinen Kameraden und versuchte, mich von dem Schrecken zu erholen, der mir in die Glieder gefahren war. Wir liefen weiter als wäre nichts geschehen. Hin und wieder drehten wir uns im Gehen um und schauten angestrengt in die Finsternis. Doch zu sehen war nichts.
"Was machen wir jetzt? Wir marschieren nun schon eine Viertelstunde, und die Typen bleiben hinter uns, genau auf Abstand." An Tracy's Feststellungen war nicht zu rütteln. Was tun? Der Weg zurück war abgeschnitten, und der nächste Militärposten, zu dem wir hätten flüchten können, lag 15 Kilometer voraus im Gelände. Uns einfach in die Büsche schlagen? Dazu fehlte es an Deckung. Und für einen längeren Sprint waren unsere Rucksäcke zu schwer.
"Du, Tracy, wir müssen die dazu bewegen, das Versteckspiel aufzugeben.
Wenn wir eine ruhige Nacht verbringen wollen, sollten wir wissen, mit wem wir es
zu tun haben."
"Und wie machen wir das?"
"Wir gehen einfach langsamer und lassen sie auflaufen."
"Die sind doch in der Überzahl. Hörst Du denn nicht das Getrampel? Wenn
jeder von denen ein Messer hat, können wir beide den Löffel abgeben",
flüsterte mein nun ebenfalls nervös gewordener Begleiter. Wir verlangsamten
unsere Schritte. Lieber der in der Schwärze der Nacht lauernden Gefahr die
Stirn bieten, als Angst und Schwäche zeigen und damit erst recht zur Attacke
einladen, rechneten wir uns vor und warteten gespannt auf das, was nun passieren
würde.
"Mann, ich halt' das nicht aus! Die laufen jetzt auch im Zeitlupentempo. Die wollen uns gar nicht einholen!", zischte Tracy nach einer Weile. Die Frage: Freund oder Feind? schien beantwortet. Unsere Gegner nutzten den Schutz der Dunkelheit, um uns zu verunsichern. Nur ihr Schuhwerk tönte durch die Stille; mit graueneinflößender Wirkung.
Und was für Geräusche das waren! Kein zackiges Aufschlagen harter Sohlen auf dem Asphalt, sondern mehr sporadisches Schlurfen und Schaben, das von achtlos dahingeworfenen Schritten Kunde gab. Ihrer Überlegenheit völlig sicher, schienen die fünf oder sechs Gestalten hinter uns ganz und gar leger ihren Angriff vorzubereiten!
"Tracy, das sind arme Leute, die uns da im Nacken hängen. Die haben Schibschibs an. Vielleicht ist das unsere Chance!" Schibschib, billige Plastikpantoffeln, in ganz Ägypten beliebt. So ähnlich, wie dieses Wort ausgesprochen wird, klangen die Geräusche hinter uns und zerschnitten die Stille. Scheeeb – Scheb... Scheeeb – Scheb.... Im Geiste sah ich ein Dutzend plastikbeschuhter derber, brauner Füße unter langen, wallenden Gewändern, die Enden der Plastik-Latschen mit jedem Schritt lässig über den Boden nachgezogen. Darüber aber, am anderen Ende der Galabejas, in Tücher und Turbane gemummte, scharf geschnittene und zu allem entschlossene Gesichter. Und mir fielen die Warnungen des Kairoer Militärs siedendheiß wieder ein: "Nehmt Euch in acht vor den Ababde, bettelarme, aber gefährliche Araber! Die heften sich an Eure Spuren und verfolgen Euch tagelang. Und wenn Ihr dann erschöpft seid, schlagen sie Euch mit ihren langen Krummknüppeln tot." Als plumpen Einschüchterungsversuch hatte ich das damals abgetan!
"Was meinst Du mit Chance?", wisperte Tracy dicht neben mir.
"Wir müssen einen letzten Versuch wagen und sie zum Essen einladen. Wenn
das nicht klappt, hauen wir ab. Vielleicht sind wir doch schneller als die in
ihren Plastiksandalen."
Wir stoppten und starrten in die Finsternis.
"Runter, Mensch! Wenn die bessere Augen als wir haben, geben wir gute
Zielscheiben ab!" Schon lagen Tracy und ich bäuchlings im Schotter neben
der Straße. Lauschen mit angehaltenem Atem. Das Schlurfen kam näher und näher
und ... verstummte plötzlich!
"Die sind stehengeblieben. Siehst Du was?" Der Himmel hob sich fast
unmerklich von der schwachen, dunstverwischten Linie des Horizonts ab, doch so
angestrengt ich auch den fahlen Streifen dicht über dem Boden aufs Korn nahm,
ich konnte die Silhouetten unserer Verfolger nicht ausmachen.
"Die sind in Deckung gegangen und lachen sich jetzt ins Fäustchen. Willst
Du es noch mit der Einladung versuchen?" Was blieb mir anderes übrig? Ich
holte tief Luft und zwang mich zu ruhiger Stimme.
"As'salama aleikum" – "Friede sei mit Euch." Schweigen.
"Kefal halkum" – "Wie geht es Euch?" Nichts rührte sich.
"Táála hena! Chaluna nemchu mábá!" – "Kommt her! Laßt uns zusammen laufen!"
Keine Antwort. Nicht das geringste Geräusch! Pattsituation. Oder hatten wir
schon verloren? Wie zwei feindliche Armeen lagen wir uns gegenüber. Und in den
Schläfen hämmerte das Herz.
Wir sprangen auf und rannten, was das Zeug hielt.
"Da drüben, vielleicht ein Hügel!" japste Tracy hinter mir. Geschenk
des Himmels! Stolpernd und völlig außer Atem erreichten wir das Bollwerk
weitab der Straße. Auf seiner Rückseite hinauf. Erschöpft ließen wir uns
unterhalb des Gipfels fallen. Rasender Puls, Lauschen, Warten. Nichts regte sich
mehr. Hurra! Abgeschüttelt waren unsere Verfolger.
Morgendämmerung. Die ganze Nacht über hatten wir abwechselnd Wache geschoben. Tracy schlief neben mir, in voller Montur, rückwärts über seinen Rucksack gekippt. Farbloses Licht überzog die Wüste mit wachsener Blässe.
"Kamele!" Im Feldstecherrund sah ich sie nicht weit von uns in einem flachen Wadi. Die schlurfenden Schritte, das Abstand halten..., mit einem Schlag alles geklärt!
"Wir Idioten! Es waren Kamele!" Tracy hatte sich aufgerichtet.
"Das glaube ich nicht."
"Doch, dort unten stehen sie. Sieben Stück. Ein Hengst mit gefesselten
Vorderläufen ist auch dabei." Wir liefen vor zur Straße, fanden ihre
Spuren.
"Klar, daß die nicht mit uns zusammen abendessen wollten. Vielleicht
versuchen wir es mal mit einer Einladung zum Frühstück."
Wenig später standen wir bei den Kamelen, schauten in ihre dunklen, tiefen Augen, die so voller Ruhe sind. Fladenbrot und getrocknete Datteln, fast unser ganzer Proviant verschwand in ihren Mäulern. Nach der Fütterung blieben sie in unserer Nähe, zupften hier und da an einem abgenagten Dornenbusch.
Ein Gefühl der Begeisterung hatte uns ergriffen; umringt von stillen Tieren, in menschenleerer Weite! Wir verbrachten den ganzen Vormittag in dem steinigen Wadi. Bis die Kamele im Gewirr der Geröllbänke verschwanden.
"Ich habe nur noch Käse und Trinkwasser. Damit können wir nicht auf Strecke gehen", sagte Tracy. Mit meinem Proviant stand es nicht besser, und so gaben wir unsere Wanderung auf, noch ehe sie richtig begonnen hatte, fuhren zurück nach Kairo.
Dort trennten sich unsere Wege. Tracy flog nach Chicago. Er arbeitet in einer Luftfrachtfirma. Manchmal schickt er mir noch eine Ansichtskarte. Kurzurlaub in irgendeinem Teil der Welt.
Ich blieb in Ägypten. Fasziniert von der Wüste, von ihrer Endlosigkeit und Stille, berauscht von ihren Nächten und vom Stillstand der Zeit. Das Erlebnis am Roten Meer, es hatte in mir etwas angestoßen, was nicht mehr verstummte. Ein Funke war übergesprungen und hatte ein Feuer entfacht.
Bald darauf schloß ich mich einer Karawane an, zog mit großen Herden kreuz und quer durch den Sudan, lernte mit Kamelen umzugehen. Bis ich mich allein, mit eigenen Tieren, tief in die Wüste wagte. Auf der Suche nach Abenteuer und Nervenkitzel? Dafür ist in der Wüste selten Platz. Nein, auf der Suche nach dem Leben und nach den Grenzen des Daseins. Und die Kamele? Sie wurden zum Transportmittel meiner Träume.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
![]()
Von Dakhla nach Farafra – 112 Jahre "nachgewandert"
Auf den Spuren von Gerhard Rohlfs
von Dr. Carlo Bergmann
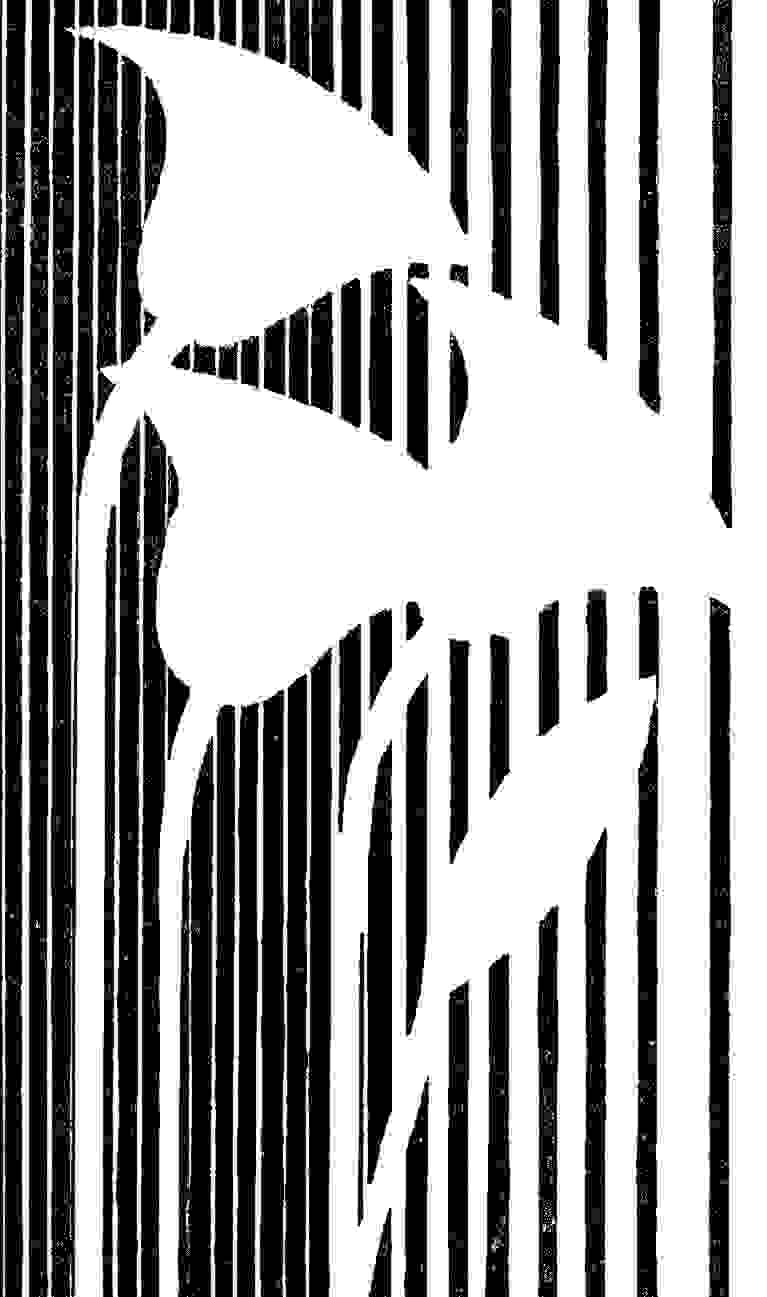 Nr. 11/85, pp. 27—32
Nr. 11/85, pp. 27—32
Ägypten. Gedränge im Niltal. Smalltalk in Tempeln und Palästen.
Verwirrspiel um Dynastien und Gottheiten. Faktenflut. Erschöpfung. Verfangen im
Labyrinth uralter Geschichten.
Hoch die Tassen beim après culture. Members only. Die Hieroglyphen tanzen.
Wiederbelebungsversuche am Pool – ausweglos.
Weg vom Sip am Cocktailglas! Geradeaus laufen. Klar denken. Platz ist da. Die
Wüste.
Ein Buch in meiner Hand. Gerhard Rohlfs: "Drei Monate in der Libyschen
Wüste." Gedruckt 1875 in Kassel. Das waren noch Zeiten. Rohlfs:
Hauptamtlicher Afrikaforscher des deutschen Reiches; großangelegte Streifzüge
über Sand und Geröll zwischen Nil und libyscher Grenze; Geld vom Sponsor. Da
stimmte die Ausrüstung. Feldbetten aus der Heimat, Zelte, Diener und Kamele.
Ein bißchen Orts- und Pflanzenbestimmung als Zeitvertreib. Und immer wieder die
Temperaturen gemessen. Langeweile kam so nicht auf, und die Angst war am Zügel.
So was will ich auch. Drei Monate! Mir fehlen Zeit und Geld. Immerhin, mein
Rucksack liegt griffbereit. Und ein Mann, der mitmacht, ist rasch gefunden.
Welchen Weg einschlagen? Bob und ich; wir entscheiden uns für die Strecke Dakhla – Farafra. Ein Blick ins Buch. Rohlfs 1873 hin, 1874 zurück. Zweimal 190 km. Identische Reisebeschreibungen. Doppelte Sicherheit mehr als 110 Jahre danach.
Ankunft in Qasr el Dakhla. Lehmziegelgesäumte Gassen – menschenleer. Staub und Sand dämpfen den Tritt. Geborstenes Mauerwerk. Hitzegesprengte Ziegelornamente über Trümmerhaufen. Tauben nisten im Lehm der Hausgerippe. Ein Esel kreuzt unseren Weg. Das alte Minarett. Die Stufen hinauf. Unter uns die Stadt. Siesta permanente. Platt und still das Häusermeer. Keine Kamele, keine Karawanen. Weggeblasen ist die Aufbruchstimmung.
Im Hitzeflimmer das schwarze Band der Western Desert Road. Neue Siedlungen in
der Wüste. Dort quillt Wasser aus der Tiefe; tränkt die Felder. Im Norden
schroffe Klippen. Träge schwappt die Mittagshitze gegen den Steilabfall. 250
Meter hoch. Irgendwo in der langen, zerklüfteten Felswand hatte Rohlfs den
Aufstieg geschafft. Runter vom Turm. Ein dunkles Loch im Mauerwerk. Licht. Ein
Mensch, ein Laden. Es gibt nicht viel. Wir kaufen Käse, Datteln und Brot. Dann
ein Hof, Schafe, Kinder, Frauen. Zehn Piaster Bakschisch. Trinkwasser. Auf
Köpfen balanciert. In Blechdosen. Wir verstauen es in den Rucksäcken.
Fünfzehn Liter pro Mann. Vorrat für vier Tage.
"Wo wollt ihr hin!"
"Nach Farafra."
"Zu Fuß?"
Eine Hand weist zur Klippe.
"Da hinten ist der alte Karawanenpfad. Kein Mensch geht ihn mehr."
Die Rucksäcke sind geschnürt. Um uns die Frauen. Verschleiert. Schwarzer
Tüll über tiefbrauner Haut. Dunkle Augen erwartungsvoll auf uns gerichtet. Da
hilft kein Rumnesteln am Gepäck. Wozu Zeit schinden? Wir müssen alleine los.
Zwei Uhr nachmittags. Lieber wären wir geblieben.
Nach einer halben Stunde die erste Verschnaufpause. Schultermassage. Blick
zurück. Schwarze Tupfer im Grau der Lehmziegelbauten. Noch einmal Abschied
nehmen.
Wir durchschreiten ein sanft ansteigendes Wüstental. Richtung Nord-West. Die
ersten Steinmänner – aufeinandergeschichtetes Geröll, Wegweiser für die
Karawanen. Der alte Pfad. Zu beiden Seiten zerrissener, zackiger Fels, immer
näher rückend. Nach drei Stunden das Talende. Wir müssen steil bergan.
Treibsand. Versinken im weichen Untergrund. Rutschen, Stolpern, rasender Puls.
Schweißnaß. Keuchender Kampf hangaufwärts. Endlich. Die Höhe ist erreicht.
Rast vor einem mächtigen Felsdurchbruch. Erschöpft sinken wir zu Boden. Bilder
vergangener Zeiten vor geschlossenem Auge. Rohlfs und seine Karawane: Schaben
und Schleifen über sandigem Grund. Anspornende Rufe der Treiber. Fluchen.
Dumpfes Kamelgebrüll.
"Bei dem steilen, sandigen Anstiege, der zu diesem Engpasse leitet, stürzten einige Kamele, andere warfen ihre Ladung ab. Schließlich erreichten wir ein großartiges Thor, von so kolossalen Felsen gebildet, daß es auch in Europa ein Touristenziel bilden würde."
Rohlfs hatte nicht weit von hier gelagert. Nach Unfällen und mühseliger Plackerei neue Kräfte gesammelt. Und diese Passage "Bab el Jasmund" getauft. Kartographen halten sich noch heute daran. Der Name, auf lateinisch und arabisch in die östliche Felswand geritzt. Wir finden die Inschrift nicht.
Sonnenuntergang. Die Farben vibrieren. Transparente Luft verstärkt Kontraste. Töne und Nuancen im Wettstreit miteinander. Das Rotgelb der Sandfluten umspielt blaugraue Hügel, wogt gegen dunkles Violett der Felsgrate, erklimmt leuchtendes Weiß in den Flanken des Steilabfalls. Die Schatten wachsen, lassen die sandige Brandung von Minute zu Minute stärker anschwellen. Dann die Dämmerung. Schwindendes Licht. Konturen und Farben verblassen. Seidiger Schimmer glättet Wirbel und Kaskaden.
Später das milchige Grauschwarz der Mondnacht. Kälte fällt vom Himmel. Handschuh über fröstelnden Fingern. Die Jacke zugeknöpft. Durch das Felsentor. Vor uns schlängelt sich der alte Pfad, folgt dem natürlichen Lauf des Geländes. An Hügelflanken entlang, durch dünengesäumte Täler, von Paß zu Paß. Bald darauf verliert sich die Piste im Gewirr bizarrer Kalkblöcke. Weit und breit keine Markierungen. Wir irren zwischen weißglimmenden Klötzen umher, tasten uns über das Dunkel der Schattenflächen. Das Felschaos will kein Ende nehmen.
"Hunderte von ungeheuren, seltsam geformten Felsblöcken thürmten sich um uns auf, und welche Gestalt die Phantasie sich auch schaffen mochte, man konnte sicher sein, sie bald zu finden. Da sah man Sphinxe, Büsten berühmter Männer, Dome, Thiere, kurz die Natur hatte hier auf die sonderbarste Weise Formen aus den vereinzelten Felsblöcken geschaffen. Es war übrigens schwierig, durch dies Felslabyrinth den Weg zu finden, so daß wir einmal uns ziemlich weit verliefen."
Gegen 1 Uhr morgens ein Steinhaufen. Sandverwehte Spuren. Wir sind wieder auf der alten Trasse.
Weitermarsch nach kurzem Schlaf. Der neue Tag bringt fühlbare Entlastung. Vier Kilo Nahrung und Trinkwasser sind verbraucht. Griff zum Wasserkanister, öfter als vorgesehen. Wasser im Körper drückt ja nicht auf die schmerzenden Schultern. Leichteres Gepäck gleich rascheres Vorwärtskommen. Trugschluß? Richtig gedacht? Dumpfe Angst vor Rechenfehlern. Rohlfs, von Farafra kommend, verlor bis hierher sechs Kamele. Haushalten mit dem Wasser. Oberstes Gebot.
Am späten Vormittag passieren wir die letzten Felsklippen. Dahinter ein breites Schotterfeld. Nach ihm der Sand. Von einer Anhöhe aus erblicken wir endloses Dünengewirr. Grellgelbe Kessel, messerscharfe Rücken bis zum Horizont.
Unser Pfad schwenkt ab. Auf eine breite, dunkle Schneise im riesenhaften Ozean. Schwarzblauer, stahlfarbener Schwefelkies zwischen hell-leuchtenden Dünenzügen.
"Einen eigenthümlichen Anblick gewährte diese Farbe, schien die Sonne darauf und noch mehr bei Abendbeleuchtung; man glaubte einen geschmolzenen und dann erstarrten Eisenstrom vor sich zu sehen."
Dunkler Glanz, durch gelbe Dünen auf beiden Seiten gehoben. Nur selten
schwappt ein heller Brecher über den platten Streifen und vermischt sich mit
dem rostig schillernden Untergrund.
Gegen Abend Abwechslung. Weiße Kalkhügel durchbrechen das Braun-Violett der
breiten Schneise. Dahinter die Sandallee wie gehabt. Schnurgerade. So weit das
Auge reicht.
Im Zwielicht zwischen Tag und Nacht laufen wir eine verlassene Start- und Landepiste entlang. Flugzeuge und Lastwagen haben helle Spuren in den schwarzen Kies gefräst. Als wären sie von gestern. Unweit zerbeulter Benzinkanister und verblichener Verpflegungspackungen ein Grabstein. Hier machen wir Pause, bereiten unser Abendessen. Am nächtlichen Sternenhimmel der helle Schimmer des Zodiaklichts. Immer wieder Blick hinauf in die lautlos strahlende Pracht.
"Und mochte die Müdigkeit vom Tagesmarsch auch noch so groß sein, der leuchtende Canopus im Süden wurde doch bewundert, man freute sich des schönen Orion, der Plejaden, der Cassiopeja, des Sirius, des Königs der Sterne, man discutierte Angesichts des phaenomenalen Zodiaklichts, dessen Ursprung, bis der Ruf der deutschen Diener daran mahnte, der Augenblick der Abendmahlzeit sei gekommen."
Aufforderung zum Dinner. Wie gerne wären wir gefolgt. Ja, Rohlfs hatte es gut. Wüste, genommen in Herrenreitermanier. Fein. In Gedanken sehen wir üppig gedeckte Tafeln vor uns. Und träumend stellt die Phantasie aus der eintönigen Datteln – Käse – Brot – Vesper gewagte kulinarische Kompositionen zusammen. Wasserkanister statt Champagnergläser. Wir prosten uns zu. Schwören, nach der Rückkehr in Kairo den Träumen vom köstlichen Essen die Taten folgen zu lassen. Einstweilen jedoch geschmackliche Abwechslung nur durch im Tagesverlauf schwankende Trinkwassertemperaturen. Gegen 23 Uhr Mondaufgang. Wir stapfen wieder durch die Stille. Bis nachlassende Kräfte die Nachtruhe erzwingen.
Die ersten Sonnenstrahlen wärmen uns, als wir am Qur Zuqaq aus den
Schlafsäcken kriechen. Qur Zuqaq: Glashügel. Wir wundern uns. Was für ein
Name für diesen Kalkbuckel! Wie der Schlußstein in einem riesigen Mauerwerk
riegelt er das lange Tal ab, durch das wir während der Nacht gewandert waren.
Von hier aus schiebt sich die sandige Dünung eng zusammen. Überspült den
schwarzen, kiesigen Grund. Den ganzen Tag ermüdender Kampf mit weichem
Flugsand. Mit pulvrigem Kalk.
Bob fällt zurück. Er läuft in Straßenschuhen. Zerriebene Haut, blutende
Füße. Mich treiben die schmerzenden Schultern. Nur die drückende Last
loswerden! Der Schmerz frist sich in den Hinterkopf. Ich laufe wie besessen.
In den Pausen Warten auf Bob. Um mich herum Stille. Herzklopfen. Blut rauscht in den Adern. Seit Dakhla laufen wir in diesem Vakuum. Weit und breit kein Zeichen von Vegetation. Die Stille preßt gegen das Ohr, zerfetzt kaltblütig das Gemüt. Wann endlich ein Geräusch? Die Sinne, in gespannter Erwartung auf diesen Augenblick gerichtet.
Bob taucht auf. Flackernde Hitzewellen umzingeln seine Gestalt. Verwischte Grenzen zwischen Körper und Raum. Dann ist er bei mir, kippt mit dem Rucksack in den Sand. Neue Erfahrungen. Auf sich gestellt sein. Ohne Mätzchen. Er klagt nicht.
Farafra rückt nicht von alleine näher. Wieder die Dünen entlang. Über grauen Kreidemergel. Weißes Licht verbrennt die Farben.
"Kann man sich etwas Trostloseres denken, etwas Langweiligeres, als die Gegend, welche wir jetzt zu durchziehen hatten? Rechts und links 80—100 Meter hohe Sanddünen, etwa ½ Stunde von einander entfernt. Und in dieser von beiden Sandketten gebildeten Thalrinne bewegt sich unsere Karawane. Da ist kein Fels, kein Gor, kein Berg, um etwas Abwechslung in die Szenerie zu bringen. So wie die Gegend hier aussieht, so sieht sie nach 4-, nach 8-, nach 20stündigem Marsche noch aus."
Rohlfs ausgeruht. Landschaft vom Kamelrücken gelassen verdaut.
Irgendwo Übernachtung. Vor Sonnenaufgang sind wir wieder auf den Beinen.
Dunkeldrohende Wolkenstreifen am Himmel. Abwägen der Wasserreserven.
Trinkwasser, nur noch für eineinhalb Tage. Angst treibt uns voran. Gegen 9 Uhr
Wind. Grell-leuchtende Schleier. Sand driftet über die wellige Weite. Nur
keinen Sturm! Wir brauchen die Sicht. Dicht hintereinander hasten wir weiter.
Kurs Nord-Nordwest. Unruhe, Anspannung, Tücher über geplatzten Lippen. Taub
schlägt die Zunge gegen trockenen Gaumen.
Nachmittags legt sich der Wind. Aus der Gefahr! Alhamdulillah! Im Rund des
Feldstechers Palmengebüsch am nördlichen Horizont. Bir Dikka! Wettlauf mit der
untergehenden Sonne. Es dauert fast drei Stunden, bis wir den Brunnen erreichen.
Rohlfs hatte hier Wasser gefaßt. Aus nur eineinhalb Fuß Tiefe. Vollkommen süß.
"Der Brunnen, 2½ Fuß im Durchmesser, ist durch eine Thonschicht durchgearbeitet worden. Ein Trinkgeschirr in Gestalt eines noch zu gebrauchenden zerbrochenen Topfes liegt für den Wanderer daneben."
Wir finden die Stelle. Das Wasserloch. Mit einem tonnenschweren Betondeckel
verschlossen. Wehe dem, der auf Bir Dikka die letzte Hoffnung setzt. Abgemattet.
Würgen an Käse und Datteln. Ab und zu ein wenig Wasser. Schal. Aus dem
Kanister. Über uns das Wiegen der Blattfächer. Äste reiben sich im Luftstrom.
Vergessen geglaubtes Rauschen. Die Hand gleitet über Palmzweige und
Blattprofile. Leben. Wir sind froh.
Auch Rohlfs fand Gefallen an diesem Flecken.
"Der Ort ermangelt nicht eines gewissen Reizes. Palmgebüsch, aus dem zwei schlanke, männliche Palmen majestätisch emporragen, steile Kalkfelsen, die großartigen Dünen – ein ächtes Wüstenbild. Denke man sich dazu unsere Karawane in verschiedenen Gruppen, hier die europäische Abteilung mit den schönen Pariser Zelten, dort die westlichen Araber, hier die östlichen, die prasselnden Feuer, die geräuschvoll ihr Abendessen zermalmenden Kamele, dazu die wunderbaren Tinten der Abendbeleuchtung, bis die Sonne ihr letztes Licht auf dem weiblichen Gestein aushauchte."
Am Morgen kreischende Raben. Verschlafen! Hastig packen wir zusammen. Nur noch wenige Schluck Wasser. Schritt für Schritt über loses Schottergestein. An den Gunna-Hügeln und an einem Palmgarten vorbei. Bob humpelt. Ein rosa Luftballon steigt vor uns in den Himmel. "Wie jeden Tag um diese Zeit," sagt der Oasenmetereologe. Händedruck. Wir sind am Ziel.
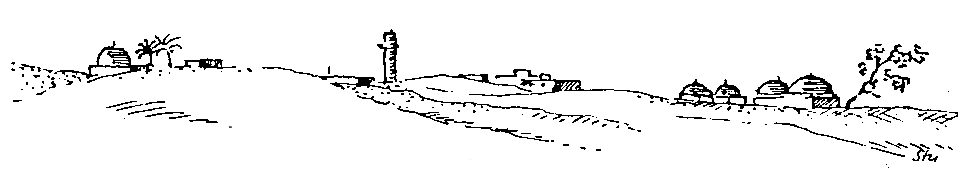
Wenig später führt uns ein Soldat zur Quelle Ain el-Balad am Ostrand von Farafra, wo sich sprudelnde Wassermassen aus 200 m Tiefe in ein großes Betonbasin ergießen. Wir reißen die verschwitzten Klamotten vom Leib und springen hinein. Schwimmen inmitten der Wüste! Wir können es kaum fassen. Eben noch geizen mit den letzten Tropfen Trinkwasser und nun umspült vom prickelnden Naß! Labsal für die geschundenen Glieder. Erleichterung, Stolz auf das Vollbrachte.
Rohlfs und seine Helfer waren später wieder von Farafra nach Dakhla gezogen. Wir denken nicht im Traum daran, es ihnen noch einmal gleichzutun.
Das Buch G.Rohlfs', "Drei Monate in der Libyschen Wüste" von 1875 wurde im letzten Jahr (1984 –Anm. KFN) wieder aufgelegt.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
![]()
Von Kairo nach Abu Simbel
Mit Karte, Kamel und Kompaß durch die Westliche Wüste
von Carlo Bergmann
in 3 Teilen
Teil 1 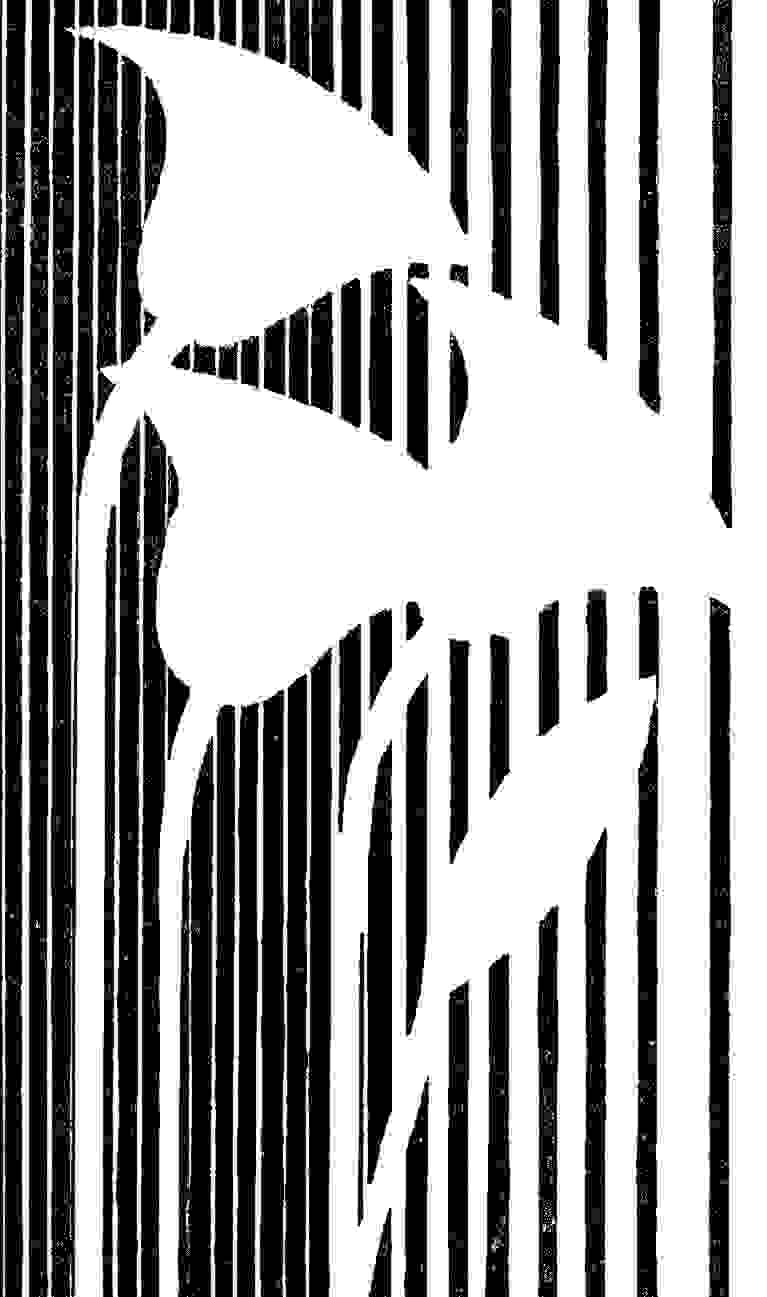 Nr. 3/87, pp. 44—47
Nr. 3/87, pp. 44—47
Wie Lawrence of Arabia die Wüste zu erforschen, alten Kamelrouten nachzureiten, ursprünglich wie die Beduinen zu leben – das mag man sich wohl manchmal schon gewünscht haben.
Dr. Carlo Bergmann ist jemand, der sich diese Träume erfüllt. Ein Übermaß an Vorsicht und Planung scheint ihm ein Widerspruch zur angestrebten Lebensform zu sein; zu viel Schonung und Rücksicht sich selbst gegenüber würde er als Verweichlichung ansehen. Da aber für die Erfüllung seiner fast obsessiv betriebenen Träume auch ein finanzieller Einsatz von Nöten ist, fordert er andere auf, ihn auf seinen Abentertouren zu begleiten, und sein Enthusiasmus ist ansteckend.
Auf welch strapaziöses Unternehmen sie sich eingelassen haben und mit welcher fast rücksichtslosen Zielstrebigkeit ihr Expeditionskamerad seine Reiseroute verfolgt, bemerken sie meist erst spät. Mit dem Abbruch des Unternehmens bzw. einem Aussteigen aus der begonnenen Tour sind jedoch meist – neben zerbrochenen Träumen – der finanzielle Einsatz (für Kamel, Ausrüstung, Verpflegung) verloren.
Potentielle Mitreiter oder Nachahmer sollten nur bedenken, daß es einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur bedarf, sich auf solche Abenteuer einzulassen. Und daß es wiederum nicht so einfach sein dürfte, mit einem Expeditionskamerad dieser Struktur solche Strapazen zu unternehmen.
Da wir keinen unserer Leser verlieren mochten, sei vor leichtfertiger Nachahmung gewarnt.
Trotzdem glauben wir, daß die Beschreibung der ungewöhnlichen Kameltour von Kairo nach Abu Simbel unseren Lesern einen echten Lesespaß bereiten wird.
Elisabeth Claus
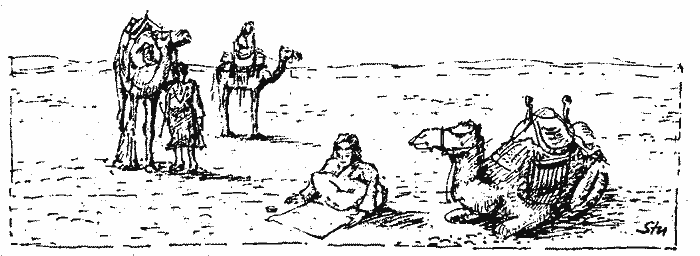
Mit Kamelen durch die Wüste. Ohne Reiseleitung, Animateur und Helfertroß. Möglich ist das – in Ägypten. Zweihundert arabische Vokabeln, mäßiger finanzieller Einsatz, Zähigkeit und Selbstvertrauen genügen für ein Abenteuer wie zu Karl Mays Zeiten.
Bob, Walter und ich. Drei Mann, ein Traum. Gemeinsam wollen wir von Oase zu Oase ziehen. Auf alten, längst verwaisten Wegen. Über hitzeflimmernde Geröllflächen. Durch Wadis und Gebirge. Eintauchen in die Stille und endlose Weite der Wüste. Für einen Monat oder zwei. Leben – frei und ungebunden wie die Beduinen.
Nachtflug Richtung Orient. An Schlaf ist nicht zu denken. Nur noch wenige Stunden. Dann wird aus Plänen Wirklichkeit. Falls alles wie am Schnürchen klappt. Unsere Hauptsorge: Auf Anhieb brauchbare Kamele für das Vorhaben finden. Tagelanges Palaver, wortreiche Vertröstungen, zum Abwarten und Teetrinken verurteilt sein – darauf sind wir nicht eingestellt.
Im Morgengrauen Landung in Kairo. Hundemüde. Ausruhen? Verweilen? Langsames Heimischwerden in der arabischen Welt? Wir wollen sofort ans Werk! Das Gepäck bleibt im Hotel. Ein Taxi bringt uns zum Kamelmarkt im Stadtteil Imbaba.
Der Markt quillt über vor Kamelen. Anfang Oktober. Hauptsaison für Schlachtviehkarawanen aus dem Sudan. Die meisten Tiere bieten einen erbärmlichen Anblick. Ausgemergelt und erschöpft vom langen Marsch, zu trostlosen Pulks zusammengepfercht, umstellt und abtaxiert von Routiniers in wallenden Gewändern, harren sie dumpf und teilnahmslos auf ihr Schicksal. Nur gelegentlich kommt Bewegung in die Herden. Wenn aufgekauftes Vieh für den Gang zur Schlachtbank abgesondert wird. Dann ertönen die Rufe der Treiber. Und das harte Klatschen ihrer Knüppel schreckt die Tiere aus der Lethargie. Staub wirbelt auf, vermischt sich mit den Rauchschwaden abseits schwelender, benzinübergossener Kadaver, legt sich wie ein Leichentuch über das Gewühl und das Gewoge der todgeweihten Leiber. Die beschwerliche Reise vom Südrand der Sahara fordert bis zuletzt einen hohen Tribut.
Wir suchen den ganzen Vormittag nach geeigneten Lastkamelen, drehen Runde um Runde auf dem überfüllten Markt. Vieles will bedacht sein, und das richtige Tier für den Metzger ist noch lange nicht unsere erste Wahl. Als einziger im Trio mit Karawanenerfahrung achte ich besonders auf makellose Fußballen, intakte Brustschwielen, Räudebefall und Satteldruckstellen. Erst am zweiten Tag haben wir Glück. In einer neu eingetroffenen Herde entdecken wir drei Bullen, die den Gewaltmarsch durch die Wüste ohne nennenswerte Schäden überstanden haben.
Musa Abu Al Kasim, Kamelhändler und Besitzer der Herde, macht nicht viel Aufhebens um unsere Kaufabsichten, verzichtet sogar auf das landesübliche Feilschen.
"Je siebenhundert Pfund für die beiden Großen, vierhundertfünfzig für den Kleinen. Das ist der Schlachtpreis", sagt er beiläufig und gibt uns Zeit, in den Umsatztabellen des Marktaufsehers zu blättern. Der Preis stimmt. Wir zögern nicht lange, kaufen die Tiere und von den sudanesischen Kameltreibern noch Packsättel dazu.
Wohin mit den Kamelen? Auf dem Markt können wir nicht bleiben und ein Hotel, das die kleine Karawane aufnehmen würde, gibt es in Kairo nicht. Sollen wir außerhalb der Stadt am Rande der Wüste kampieren und dort unsere Vorbereitungen für den Abmarsch treffen? Warum noch überlegen. Es bleibt ja keine andere Wahl. Wir verlassen den Markt und bahnen uns mitsamt den strohbeladenen Vierbeinern einen Weg durch den tosenden Verkehr hinaus nach Giza.
Einen Steinwurf von den Pyramiden entfernt finden wir Quartier. Um uns die monumentalen Zeugen einer jahrtausendealten Kultur. Welch ein geschichtsträchtiger Ort als Ausgangspunkt für die bevorstehende Wanderung! So wie wir heute, mögen zu Zeiten der großen Kameltrecks ungezählte Karawanen im Schatten der gigantischen Grabmäler gelagert haben, ehe sie zur Durchquerung der Libyschen Wüste aufbrachen. Und während unsere Kamele geräuschvoll Zuckerrohr, Stroh und getrocknete Bohnen zermalmen, gleitet das Auge über die himmelhoch getürmten Steinblöcke, bis es sich im würfeligen Schichtgefüge der kolossalen Bauten verliert; schweift schließlich über dunstblasses Grün der Nilgärten und tastet an gelbgleißenden Sand- und Schotterwällen entlang, die gleich neben den Pyramiden den Auftakt zur Wüste bilden.
Die Wüste. Ihre Leere übt einen eigentümlichen Sog aus, drängt mich beständig, nach fernen Horizonten zu greifen. Ich könnte sofort loslaufen, hineinstürmen in dieses Vakuum. Geht es meinen Begleitern ebenso? Wir arbeiten wie die Teufel, um endlich startklar zu werden. Zeit bleibt da nicht, um Eindrücke und Stimmungen in Worte zu fassen.
Drei Tage vergehen, bis Proviant beschafft, Sattelkissen genäht, Sättel und Satteltaschen angepaßt sind. Dann ist es soweit. Spätnachmittag, Aufbruchzeit der Lastkarawanen seit altersher. Im Licht der untergehenden Sonne mischen wir uns mit den Tieren unter die wenigen verbliebenen Touristen und laufen eine Ehrenrunde um die Pyramiden, ehe wir mit einsetzender Dunkelheit in die Wüste entschwinden.
Jetzt endlich fühlen wir uns frei und können aufatmen. Lärm und Gedränge des Niltals sind vergessen. Unser Beduinenleben hat begonnen.
Anfangs bietet die Landschaft wenig Abwechslung. Steinübersäte Flächen, welliges Hügelland bis zum Horizont. Dazwischen vereinzelte Sandfahnen. Auf ihnen schreiten wir entlang, wann immer möglich – zur Entlastung der schwerbepackten Kamele. Sie schleppen 450 kg Gepäck. An Reiten ist da nicht zu denken. Unser Ziel: Birket Qarun, der antike See Möris in der Fayoum-Senke. Achtzig Kilometer Luftlinie von Kairo entfernt, vierundvierzig Meter unter dem Meeresspiegel, von Nilwasser gespeist. Einen Karawanenweg dorthin gibt es nicht. Und auch keinen Schatten. Die Sonne, sie brennt stärker als erwartet. An zehn Uhr wickeln wir uns in unsere Tücher. Nur gut, daß wir für die Wanderung Kleider in Landestracht tragen. Turban und Galabiya lassen genügend Luft an die schweißnassen Körper und schützen zugleich vor den sengenden Strahlen. Unser Wasserkonsum: Satte sechs Liter pro Mann und Tag. Kein einziger Tropfen davon für die Körperpflege. Die glühende Hitze macht uns arg zu schaffen. Ärger als befürchtet. Hätten wir uns länger akklimatisieren sollen, ehe wir uns solchen Strapazen aussetzen? Wären wir doch bald am See! Schwimmen im kühlen Naß, von mehr träumen wir nicht.
Wir stampfen Schritt für Schritt über das sonnengleißende Terrain, bis mit einem Male eine steilabfallende Geländestufe uns den Weg versperrt. Grandioser Blick auf das unter uns liegende Land. Blauschimmernd der See in der Ferne. Davor breite Terrassen, dunkelfarbene Plateaus, wild ineinandergeschobene Hügelreihen. Nach Osten hin einige Tafelberge, umströmt von breiten, buschbesetzten Wadis.
"Das ist ja das gähnende Nichts!"
Walter hat neben mir gleichgezogen und starrt mit weitaufgerissenem Mund in die Tiefe. Enttäuschte Erwartungen. Hat er sich die Wüste anders vorgestellt? Seine Vorbereitungen: Walt Disney's "Die Wüste lebt" und David Lean's "Lawrence von Arabien" – einmal pro Woche. Mentales Training mittels Videokassette im heimatlichen Köln; Fertigkost aus Hollywood, zu schwach gewürzt, um auf Dauer zur Stärkung des Durchhaltewillens geeignet zu sein.
"Du bist hier nicht in Disneyland", sagt Bob mit leichtem Stirnrunzeln und sucht nach einem Abstieg von der Klippe. Er muß es wissen, er kommt aus Amerika.
Walter fällt zurück. Der dritte Wandertag! Wächst ihm die Wüste über den Kopf? Wir laden das leichter gewordene Gepäck um und setzen ihn auf ein Kamel. Zur Aufmunterung. Die hält nicht lange vor, denn auch das Reiten will gelernt sein.
Der direkte Weg zum See ist zu gefährlich. Tückische Sümpfe begrenzen sein Nordufer. Darin wollen wir nicht mit Mann und Kamel versinken. Also nach Westen; durch das Auf und Ab der Felsplateaus. Zwei Tage verrennen wir uns in den Bergen – ohne nennenswertes Vorwärtskommen. Das ständige Klettern ermüdet die Tiere. Mitten in einem Steilhang rutscht ein Tier aus, verliert das Gleichgewicht und stürzt. Gottseidank kann es sich an der Schräge halten. Keine Verletzungen, keine Verluste. Klüger geworden ziehen wir hinunter in die öden Niederungen am Seeufer, tasten uns über sandige Flächen an weitläufigen, schollenartig zerklüfteten Krustenbereichen entlang. Die berüchtigte Sebchah – salzige Schlammsümpfe, in ziemlicher Entfernung vom Wasser noch metertief.
Keine Spuren vor uns, die den Weg durch dieses Gelände weisen könnten.
Hoffentlich trägt der Grund. Ich gehe als Erster, stochere mit einem Ast im
Boden und halte nach verdächtigen Zeichen Ausschau. Plötzlich ein Ruck an der
Leine. Ich drehe mich um und sehe das Tier wie eine Marmorstatue senkrecht in
den Boden sinken. Der Bulle, starr vor Schreck, zuckt nicht einmal mit den
Wimpern!
Glück im Unglück. So lang die Beine des Kamels, so tief ist auch der Sumpf an
dieser Stelle. Doch wie um Himmelswillen das hilflose Tier befreien? Wir haben
keinen Spaten. Es seinem Schicksal überlassen? Töten? Ausgerechnet unser
stärkstes Kamel hat es erwischt! Die Wanderung hier bereits zu Ende? Mit
blanken Händen machen wir uns an die Arbeit; kratzen, schaufeln, graben wie
besessen. Wässriger Salzbrei läuft unaufhörlich nach, wird mit dem
Futtereimer abgeschöpft.
Nach fünf Stunden ist die Rettungsaktion geglückt. Verdreckt und abgemattet
liegen wir uns in den Armen. Walter stöhnt: "Meine Hände! Mir reicht's
ich will nach Hause!"
"Halt' durch bis Kasr Qarun", fauche ich und deute auf Moschee und
Gärten am gegenüberliegenden Seeufer, "dort bekommst Du vielleicht einen
Bus und bist in sechs Stunden in Kairo."
Es dauert noch einen Tag, bis unsere Greenhornkarawane um die Westspitze des
Sees gezogen ist und schließlich den Ort erreicht.
Sandsturm auf den letzten Metern. Seit dem frühen Morgen staubverhangener Himmel, trübes Licht. Sand und Unrat wirbeln durch die Gassen. Walter kann es kaum erwarten wegzukommen. Endlich die Erlösung! Es ist noch Platz für ihn im Bus. Abschied in aller Kürze. Er denkt nur noch an die Heimat; an Dusche, Bier und Currywurst.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()
Teil 2 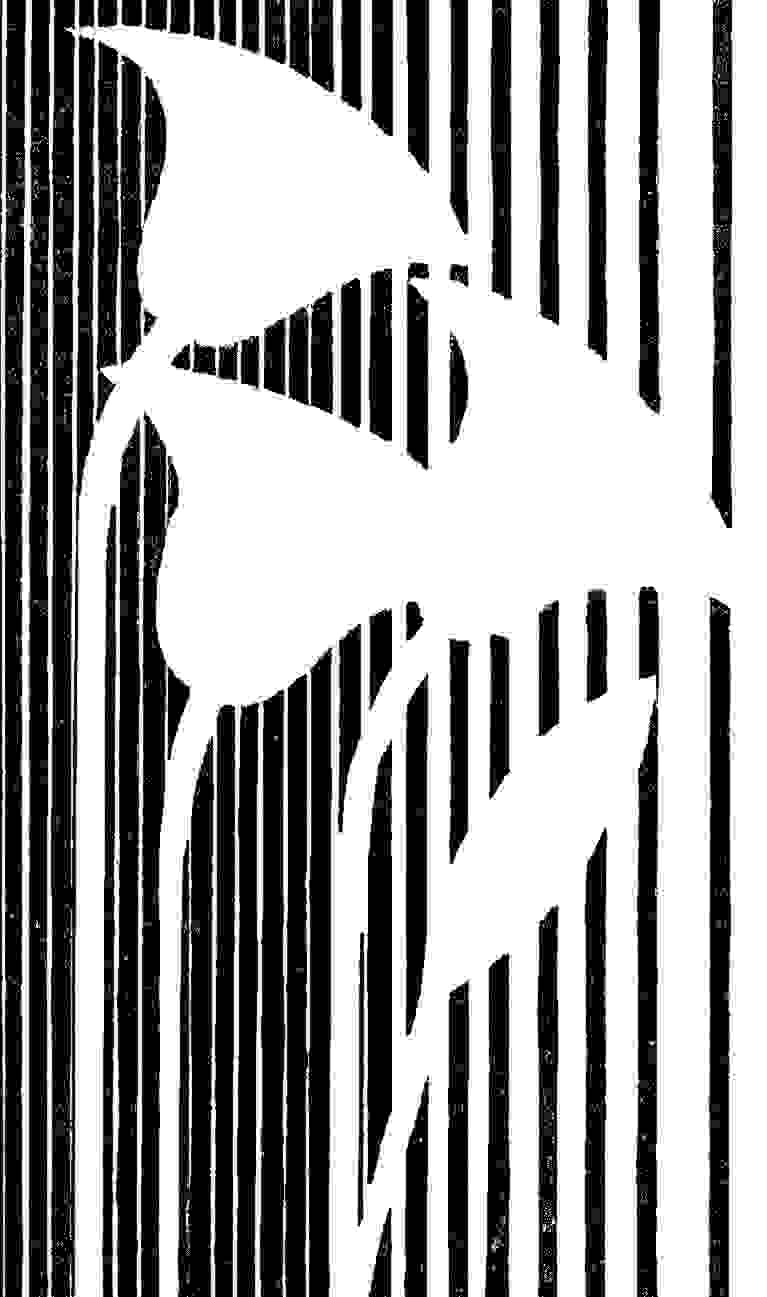 Nr. 4/87, pp. 60—61
Nr. 4/87, pp. 60—61
Bob und ich sind umringt von staunenden Gesichtern, beantworten pausenlos dieselben Fragen. Woher? Wohin? Wie teuer? Kamera, Uhr, Kamel... Nichts bleibt untaxiert. Wir freuen uns, nach Tagen der Einsamkeit wieder unter Menschen zu sein. Hilfsbereite Hände schleppen Futter für die Tiere, Proviant und Trinkwasser herbei. Doch der Sturm läßt uns nicht heimisch werden, zerrt unaufhörlich an den Kleidern, bläst uns den Staub in die Gesichter.
Nur weg von hier! Wir wollen raus aus der Stadt; zu den Ruinenfeldern des antiken Dionysias, äußerster Vorposten der römischen Provinz und Ausgangspunkt einer 2000 Jahre alten Karawanenstraße. Sie führt zur Bahariya-Oase, zweihundert Kilometer weiter im Westen. Inmitten der Trümmerhaufen ein gut erhaltener Tempel. Spätptolemäisches Gemäuer aus hartem Kalkstein; zwanzig mal siebenundzwanzig Meter, zehn Meter hoch. Hier ist genügend Windschutz. Und Polizei, die uns den Weg in die Wüste versperren will.
Nach längerem Katz-und-Maus-Spiel gelingt es, uns im Schutze der Dunkelheit aus dem Staub zu machen. In diesem Moment nach der alten Straße Ausschau halten? Dazu fehlen Sicht und Nerven. So stapfen wir zwei Tage über wegloses Ödland, ehe die von Kamelen- und Menschen getretenen, gewundenen Bänder der Karawanenstraße vor uns liegen. Es mögen etwa zweihundert schmale Furchen sein, die sich in die wenigen Kies- und Schotterflächen eingedrückt haben. Langsam verblassende Zeugen des einst umfangreichen Handels zwischen Niltal und den Oasen der libyschen Wüste. Kein Kameldung, keine frischen Spuren. Seit dem Bau der Western Desert Road wird der antike Weg nur noch selten von Beduinen begangen. Wir folgen dem sich in südwestlicher Richtung dahinschlängelnden Pfad. Er führt durch flaches, monotones Terrain.
Tag für Tag über Schotter, Sand und platten Fels. Selten eine markante Erhebung. Nur gelegentlich überspülen grellgelbe Dünenfelder die Trasse und zwingen uns zu mühevollem Auf und Ab.
Wenn der starke Nordost nur nicht wäre! Er pfeift uns schon seit dem Fayoum um die Ohren, schaufelt Kälte aus dem Kaukasus heran. Eisiger Wind und sengendes Licht. Grippewetter. Schweiß auf der Sonnenseite; Gänsehaut dort, wo der Wind uns kalt erwischt. Bald husten und spucken wir um die Wette. Während der Nacht flaut der Wind nicht ab, fegt über das deckungslose Gelände. Das Lager, am Morgen zugeweht vom Sand. Verklebte Augen, staubgraue Haare, Sand in Nase, Mund und Ohren. Schweigend machen wir uns auf den Weg.
In den Mittagspausen hocken wir um den Kocher, bereiten unsere Standardkost:
Ölsardinen, Reis und Zwiebeln. Dazu ein Glas Pulvermilch mit viel Zucker. Beim
Anblick dieser Leckerbissen schlägt die Phantasie so manchen Purzelbaum.
"Weißt Du, wie Ostfriesland aussieht?"
Bob war noch nie in deutschen Landen.
"Ungefähr so flach und wellig wie die Gegend hier. Aber grün. Und Kühe
satt. Überall. Und dann das Essen – 'Aal Grün' mit..."
Bloß keine Schwärmereien! Bloß keine Ostfriesen – Fata Morgana!
"Das hört sich gut an. Wie wär's, wenn Du ab Bahariya alleine weiterziehst.
Ostfriesland! Schlimmer als hier kann es nicht werden. Ihr habt ja auch noch das
Oktoberfest in Reserve, drüben in Old Germany. Vielleicht treffe ich dort
Walter."
Bob hält eisern an seinem Entschluß fest. Als wir nach sieben Wandertagen die
Oase erreichen, drückt er mir die Hand und steigt ins Taxi Richtung Kairo.
Allein! Was nun? Ein Beduine bietet sich als Führer an und fordert dafür ein Vermögen. Ich bin müde, sehne mich nach einem Bett. Erst einmal richtig ausspannen und neue Kräfte sammeln.
Casino Alpenblick, das einzige Ausländerhotel der Oase. Sallah Sherif, sein
Besitzer, empfängt mich mit offenen Armen.
"Die Kamele?"
"Kein Problem", sagt er, "stell sie vor Dein Zimmerfenster."
Das ganze Gebäude ist mit Motiven aus der Wüste bemalt. Ich fühle mich gleich
wie zu Hause.
"Woher der Name? Die Alpen sind weit."
"Ein Ingenieur aus der Schweiz hat hier jahrelang gearbeitet. Heimweh.
Verstehst Du?"
Abends Treff im "Nite Club". Lehmboden, wackelige Holztische, Bänke vor zernarbten Wänden. Eine verstaubte Glühbirne baumelt von der Decke; trübes Licht im hohen Raum. Aus dem Radio die Rufe des Mueddin. Danach religiöse Musik bis Mitternacht; leise Gesänge untermalen das Gemurmel. Sallah ist ganz in seinem Element. Aus einem dampfenden Topf die Mahlzeit. Röhrennudeln mit Tomatenmark. Wie jeden Abend. Fünfunddreißig Piaster kostet der Spaß. Nur die Touristen essen.
Ein paar Männer aus dem Ort erzählen Anekdoten; der fremden Frauen wegen. Bald kreist die Pfeife in der Runde, würzt die Luft im dämmrigen Lokal. Olivfarbene Uniformen in einer Ecke. Zwei Polizisten. Schläfriges Blinzeln unter abgewetzten Mützen. Sie nehmen keinen Anstoß. Die Pfeife trudelt, tanzt von Hand zu Hand. Blicke in die Ferne. Monte Rosa, Eiger, Matterhorn. Für manche gehen sie jetzt auf. Heiße Köpfe, enge Schläfen. Warten. Wann, das Alpenglühen?
Zwei Tage! Länger halte ich es im Hotel nicht aus. Diese Typen, jung und doch schon müde Krieger. Sie lassen sich im Omnibus durch die Wüste kutschieren, als wären sie auf einer Kaffeefahrt. Und verbrauchen sich durch träges Warten. Niemand, der aus diesem Kreis ausbricht. Vom Beduinen, der mit mir gehen wollte, bisher keine Spur. So ziehe ich alleine los. Die Kamele hören mittlerweile auf ihre Namen. Getauft hatte ich sie in Kairo. Den großen Braunen: "Hassan", den Weißen: "Fiffi" und den preiswerten Mageren ohne Höcker: "Bakschisch". Rufe ich einen der Drei, so dreht der bedächtig seinen Kopf zu mir und trottet auf mich zu. Manchmal nur ein paar Schritte. Kleines Entgegenkommen, große Hilfe. Das Hüten meiner "Herde" ist dadurch leicht gemacht. Keine stundenlange Verfolgung eigenwilliger Ausreißer; genügend Zeit für Navigation, Reparaturen und Vorwärtskommen.
Zum Seitenbeginn
Zum PapyrusArchiv
![]()
![]()